Das SED-Regime in Ost-Berlin unter Druck
Zusammenfassung
Die Rede, die der 1. Sekretär der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED), Walter Ulbricht, auf der 30. Tagung des Zentralkomitees (ZK) hielt, richtete sich vorrangig gegen das Konzept des einflussreichen Agrarpolitikers der Partei, Kurt Vieweg (1911–1976), der den seit 1952 rigoros vorangetriebenen ‚Aufbau des Sozialismus‘ auf dem Lande (und damit die Kollektivierung der bäuerlichen Betriebe) kritisiert hatte. Ulbrichts Verdikt war aber in eine breitere Kampagne gegen Kräfte eingebettet, die nach Nikita Chruschtschows Verurteilung Stalins auf dem XX. Parteitag der KPdSU im Februar 1956 auch in der DDR eine flexiblere Politik gefordert hatten. Unter dem Eindruck des Aufstands gegen die sowjetische Herrschaft in Ungarn im Oktober/November 1956 und der Forderungen nach Abwendung vom Stalinismus in Polen nahm Ulbrichts Macht sogar in der SED vorübergehend ab. Nachdem die sowjetische Armee das ‚Tauwetter‘ aber in Ostmitteleuropa gewaltsam beendet hatte, gewann der ostdeutsche Parteichef Ende 1956 die Kontrolle in der DDR zurück. Er entmachtete daraufhin seine innerparteilichen Kritiker, darunter auch Vieweg, der im März 1957 von allen Ämtern zurücktreten musste und in die Bundesrepublik Deutschland floh. Schon im Oktober kehrte er jedoch unter weiterhin nicht vollständig geklärten Umständen in die DDR zurück, wo er zu zwölf Jahren Zuchthaus verurteilt wurde. Die Rede ist in zwei Fassungen überliefert, die sich trotz einiger identischer Abschnitte voneinander unterscheiden. Da zu den Gründen der Differenzen keine Belege vorliegen, können in der Beschreibung der Schlüsselquelle lediglich Plausibilitätsannahmen vorgestellt werden.
Kontextualisierung
Das SED-Regime in Ost-Berlin unter Druck. Walter Ulbrichts Zurückweisung von Kurt Viewegs Agrarprogramm auf der 30. Tagung des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands am 30. Januar 1957
Arnd Bauerkämper
Voraussetzungen – Bodenreform, Kollektivierung und die Krise auf dem Lande
In den späten vierziger Jahren hatte die 1945/46 von der Sowjetischen Militäradministration (SMAD) durchgesetzte Bodenreform auf dem Lande – die Enteignung der Gutsbesitzer mit mehr als hundert Hektar, der führenden Nationalsozialisten und Kriegsverbrecher – einen kaum zu bewältigenden Problemstau verursacht, der sich vor allem in der zunehmenden Zahl wieder zurückgegebener Neubauernstellen widerspiegelte. Aber auch ‚Großbauern‘ mit jeweils mehr als zwanzig Hektar Landbesitz, gegen die das SED-Regime seit 1948 wirtschaftliche Belastungen und zunehmend auch Zwangsmaßnahmen verhängt hatte, verließen ihre Höfe. Insgesamt schwoll die Unzufriedenheit über das hohe Ablieferungssoll, das den alteingesessenen Bauern auferlegt wurde, in den frühen fünfziger Jahren zum offenen Protest an. Ihm verlieh der erzwungene Zusammenschluss zu Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften (LPG), den Walter Ulbricht als Generalsekretar des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED) auf der 2. Parteikonferenz vom 9. bis 12. Juli 1952 verkündete, kräftig Auftrieb.[1]
1952/53 wurden auf dem Lande überwiegend noch kleine Kollektivbetriebe gegründet. Diese waren aber wirtschaftlich schwach. Auch die Flucht vieler bedrängter Bauern vom Land – zum Teil sogar in die Bundesrepublik – und das Scheitern der Frühjahrsbestellung verursachten 1953 schließlich eine akute Versorgungskrise. Angesichts der alarmierenden Nachrichten verlangte die sowjetische Parteiführung, die nach dem Tod Stalins (5. März 1953) einen Zusammenbruch der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) fürchtete, die Kollektivierungspolitik vorerst einzustellen. Unter dem Druck der sowjetischen Parteiführung untersagte das Zentralkomitee (ZK) der SED daraufhin am 26. Mai 1953 die Bildung neuer LPG in der DDR.
Demgegenüber sollte Einzelbauern wieder wirtschaftliche Unterstützung gewährt werden. Am 9. Juni nahm das Politbüro die forcierte Kollektivierungspolitik auch öffentlich zurück. Außerdem konnten enteignete Landwirte die Rückgabe ihres Eigentums beantragen. Trotz dieser Zugeständnisse hatte die SED-Führung aber das Vertrauen der Bauern – und anderer Gruppen der ländlichen Gesellschaft – verloren. Es kam deshalb im Sommer 1953 in der DDR nicht nur in Ost-Berlin, sondern auch in vielen Dörfern zu Streiks und Protesten. Der Zerfall von LPG und der Austritt von Mitgliedern hielten weit über den Volksaufstand im Juni 1953 hinaus an. Bis 31. Dezember ging die Zahl der Kollektivbetriebe insgesamt von 5.074 auf 4.691 um rund acht Prozent zurück. Obwohl die SED-Führung den ‚Aufbau des Sozialismus‘ auf dem Lande keineswegs aufgegeben hatte, wirkte der Schock, den die Erhebung im Sommer 1953 in der Staatspartei auslöste, bis zu Chruschtschows Rede auf dem XX. Parteitag der Kommunistischen Partei der Sowjetunion (KPdSU) im Februar 1956 nach, in der er Stalin scharf kritisierte und damit die ostdeutschen Funktionäre erneut tief verunsicherte.[2]
Die Herausforderung – Kurt Viewegs Kritik an der SED-Politik und sein Agrarprogramm
Vor diesem Hintergrund arbeitete Kurt Vieweg 1956 ein Konzept aus, das die Planwirtschaft im Agrarsektor und die Kollektivierung der Landwirtschaft grundsätzlich in Frage stellte. Am 29. Oktober 1911 in Göttingen geboren, hatte er sich in Itzehoe der Wandervogel- und Landvolkbewegung angeschlossen, bevor er zur Hitler-Jugend und dann zum Kommunistischen Jugendverband stieß. Im Anschluss an die Machtübertragung an Adolf Hitler 1933 war Vieweg nach Dänemark geflohen, wo er im kommunistischen Widerstand arbeitete. Zudem studierte er von 1935 bis 1940 an der Landwirtschaftlichen Hochschule in Kopenhagen. Im Anschluss an die Flucht nach Schweden begann Vieweg im darauffolgenden Jahr ein Studium an der Landwirtschaftlichen Hochschule Ultuna (bei Uppsala). Obwohl ihn das genossenschaftlich geprägte Agrarprogramm der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Schwedens beeinflusste, galt er bald als Experte der Exil-KPD für Landwirtschaft. 1946 nach Deutschland zurückgekehrt, errang Vieweg in der sowjetischen Besatzungszone beziehungsweise DDR früh führende Positionen in der 1946/47 gegründeten Vereinigung der gegenseitigen Bauernhilfe (VdgB). Von 1949 bis 1954 gehörte er auch dem ZK der SED an. In der 1951 in Berlin gegründeten Deutschen Akademie der Landwirtschaftswissenschaften (DAL) leitete er ab September 1953 das Institut für Agrarökonomik. 1955 erhielt Vieweg den Nationalpreis der DDR.[3]
Nachdem er bereits 1952 wegen der ‚Westarbeit‘ der VdgB, vor allem im ‚Gesamtdeutschen Arbeitskreis für Land- und Forstwirtschaft‘ in der Bundesrepublik, und wegen seiner konspirativen Tätigkeit während der Emigration in Skandinavien kritisiert worden war, beobachtete die Parteiführung Vieweg argwöhnisch. Überdies überwachte ihn das Ministerium für Staatssicherheit (MfS). Daraufhin begann Vieweg eine akademische Karriere. Diese unterstützte die SED-Führung, die auf eine vollständige Entmachtung verzichtete, allerdings mit dem Auftrag, ein Institut für Agrarökonomik an der DAL zu etablieren. Hier konnte Vieweg auch weiterhin forschen, sodass er 1955 seine Dissertation abschloss. In dieser Studie plädierte er für eine flexiblere staatliche Lenkung der Agrarproduktion. Er forderte, das bisherige starre System der Festlegung der landwirtschaftlichen Produktion durch Anbau- und Viehhaltepläne aufzugeben und die Erzeugung und Marktleistung der Betriebe nur über die Festsetzung staatlicher Normen für Erfassung pro 10 ha LN [landwirtschaftlicher Nutzfläche; A.B.] sowie über den Abschluß von Lieferverträgen zu erhöhten Preisen oder Gegenlieferungen von Industriewaren zu regulieren.[4] Darüber hinaus nahm Vieweg betriebswirtschaftliche Erkenntnisse und Methoden auf. Demgegenüber hatte Ulbricht schon auf der 24. Tagung des ZK der SED (1./2. Juli 1955) die ‚bürgerliche Betriebslehre‘ verdammt und die Vernachlässigung der ‚sozialistischen‘ Agrarökonomie in der DDR kritisiert. In den folgenden beiden Jahren wurde die Landwirtschaftspolitik im Allgemeinen und Viewegs Agrarkonzept im Besonderen zu einem grundsätzlichen Konflikt, in dem flexiblere Sozialismuskonzepte das stalinistische Dogma der führenden Parteifunktionäre in Frage stellten. Damit war letztlich auch die Machtfrage in der SED gestellt.[5]
Auf der Suche nach einer neuen Agrarpolitik, die den Problemstau auf dem Lande beseitigen sollte, folgte Vieweg im November 1955 einer Einladung an ostdeutsche Agrarwissenschaftler, landwirtschaftliche Großbetriebe, Versuchsgüter und Ausbildungseinrichtungen in Dänemark und Schweden zu besichtigen. Die Delegation informierte sich auch über den Landwirtschaftlichen Genossenschaftsverband in Schweden und besuchte die Landwirtschaftshochschule in Ultuna. Ein anschließend von ihm verfasster Bericht, in dem er für ein genaues Studium der Landwirtschaft in Schweden eintrat und damit indirekt die Agrarpolitik der SED kritisierte, veranlasste junge, parteikonforme Mitarbeiter des Instituts für Agrarökonomik im Dezember 1955, die politische und fachliche Arbeit Viewegs scharf zu kritisieren und den Direktor gegenüber der Zentralen Parteikontrollkommission (ZPKK) zu denunzieren. Vieweg genoss aber weiterhin das Vertrauen des Präsidenten der DAL, Hans Stubbe (1902?1989).
Enttäuscht von dem Beschluss der 3. Parteikonferenz der SED (24.?30. März 1956), erneut den Übergang zu ‚sozialistischen Produktionsverhältnissen‘ (und damit auch zur Kollektivierung) zu erzwingen, und ermutigt von den Erhebungen gegen die stalinistischen Diktaturen in Ungarn und Polen im Herbst 1956, sprach sich Vieweg am 6. November offen für eine grundsätzliche Korrektur der Landwirtschaftspolitik in der DDR aus. In dem Entwurf des Agrarprogramms, den er für das Politbüro, aber ohne dessen Kenntnis zusammen mit seiner Mitarbeiterin Marga Langendorf verfasste, schlug er eine dualistische Struktur von staatlichen und genossenschaftlichen Betrieben einerseits und einzelbäuerlichen Höfen andererseits vor.
Demzufolge sollten nicht nur die LPG und die staatlichen Volkseigenen Güter, sondern auch bäuerliche Familienbetriebe so umfassend mit Betriebsmitteln ausgestattet werden, dass sie eine hohe Marktproduktion erbrachten. Außerdem sah der Entwurf vor, wieder bäuerliche Genossenschaften mit individueller Gewinnbeteiligung zu gründen. Darüber hinaus trat Vieweg für eine Aufhebung der Wirtschaftsplanung zugunsten eines einheitlichen Systems ein, in dem die Pflichtablieferung aufgehoben und Preise innerhalb einer festzulegenden Spanne nach Angebot und Nachfrage schwanken sollten. Die Staatshilfe für LPG sollte strikt auf die Steigerung der Produktion und Produktivität in den Betrieben ausgerichtet werden, die von der politischen Kontrolle der SED-Kreisleitungen zu befreien waren. Darüber hinaus verlangte Vieweg, die staatlichen Maschinen-Traktoren-Stationen (MTS), die 1948 aus Maschinenhöfen hervorgegangen waren, in bäuerliche Maschinengenossenschaften zu überführen, in denen staatliche Institutionen nur noch 51 Prozent des Kapitals stellten. Nicht zuletzt sollte den LPG eingeräumt werden, Maschinen der MTS zu übernehmen.[6]
Der Gegenschlag der stalinistischen Kräfte – Diffamierung und Entmachtung Viewegs
Seine politische Sprengkraft gewann das Konzept einer gemischten, wenngleich letztlich staatlich kontrollierten Landwirtschaft, nachdem die SED-Führung erkannt hatte, dass Viewegs Konzept die gesamte Wirtschaftspolitik des Regimes in Frage stellte. Besonders die vorangegangenen Gespräche zwischen Vieweg und einem sowjetischen Funktionär im Ministerium für Land- und Forstwirtschaft der DDR beunruhigten Ulbricht und den mächtigen ZK-Sekretär für Landwirtschaft, Erich Mückenberger. Zudem wurde Ende 1956 deutlich, dass Viewegs Vorschläge nicht nur vielen Agrarwissenschaftlern, sondern auch einzelnen Staatsfunktionären bekannt waren. Die Forderung, die Kollektivierungspolitik zurückzunehmen und die staatlich-administrative Kontrolle der Landwirtschaft zu lockern, war überdies in der VdgB, im Bauernverlag und bei Mitarbeitern des Landwirtschaftsministeriums durchaus auf Zustimmung getroffen.[7]
Am 3. November 1956 übermittelte Vieweg einem sowjetischen Berater des Ministeriums für Land- und Forstwirtschaft der DDR und drei Tage später auch Ulbricht und Mückenberger den zweiten Entwurf seines Agrarprogramms. In einer Parteiversammlung im Institut für Agrarökonomik berief sich Vieweg am 12. November sogar auf die Skepsis der Bauern gegenüber der SED-Führung, deren rigide Kollektivierungspolitik er nunmehr scharf ablehnte. Demgegenüber plädierte der Institutsdirektor auf Grundlage seiner Ausarbeitung offen für eine Stärkung der bäuerlichen Familienbetriebe. Am 29. November ordnete Mückenberger an, die inzwischen verschickten Exemplare des von Vieweg verfassten Entwurfs zu beschlagnahmen. Im Dezember 1956 und Januar 1957 ließ der Parteisekretär im Institut für Agrarökonomik der DAL, Rolf Zierold, außerdem vier Versammlungen der SED-Mitglieder durchführen, an denen auch hohe Funktionäre aus dem Parteiapparat wie Mückenberger und der Mitarbeiter der Landwirtschaftsabteilung der SED teilnahmen. In den Parteiversammlungen, die am 3. und 10. Dezember 1956 im Institut stattfanden, verteidigte Vieweg entschieden sein Agrarkonzept. Am 3. Januar 1957 hielt er zwar an seiner Kritik fest, bezeichnete die Ausarbeitung seines Agrarprogramms aber erstmals als Fehler. Nachdem die SED-Versammlungen das Konzept nochmals kategorisch zurückgewiesen hatten, verabschiedete die Parteiorganisation eine Entschließung, in der Viewegs Vorschläge scharf verurteilt wurden.[8]
Ulbricht rechnete auf der 30. Tagung des ZK am 30. Januar schließlich mit seinen innerparteilichen Kritikern ab. Dazu gehörte auch Fred Oelßner, der dem Politbüro angehörte, in der Agrarkommission des ZK arbeitete und in diesem Gremium für die Versorgungspolitik zuständig war. Er war auf der 28. und 29. Tagung des Zentralkomitees im August und November 1956 mit der Forderung hervorgetreten, nicht nur das Kollektivierungstempo zu verringern, sondern auch unrentable LPG und MTS aufzulösen. Ebenso wie Vieweg verlangte der einflussreiche SED-Funktionär, mit staatlichen Finanzhilfen die Betriebe der verbliebenen Einzelbauern zu stärken. Ähnlich hatte Karl Schirdewan, der von 1953 bis 1958 dem ZK der SED und dessen Politbüro angehörte, seine Vorbehalte gegen die Politik Ulbrichts mit dem Ziel gerechtfertigt, jedes einzelne Beispiel vom fehlerhaften Herangehen für die Gewinnung zum Eintritt in die LPG durch die Kreisleitungen auswerten zu lassen, um so die Flucht von Bauern nach Westdeutschland einzudämmen.[9] Alle diese Vorschläge wies Ulbricht auf der 30. ZK-Tagung kategorisch zurück.
Wie beide Überlieferungen der Schlüsselquelle zeigen, stigmatisierte der Parteichef dabei Viewegs Programm als konterrevolutionäre Konzeption, da es auf eine Restauration des Kapitalismus in der Landwirtschaft ziele. Außerdem beschuldigte er SED-Agrarexperten, die sich gegen die Zwangskollektivierung gewandt hatten, Reste ihrer bürgerlichen Ideologie noch nicht überwunden zu haben. Auch Mückenberger verurteilte Viewegs Agrarprogramm in der ZK-Tagung als oberflächlich und unwissenschaftlich. Der ZK-Sekretär für Landwirtschaft stellte dem Konzept das Ziel der Staats- und Parteiführung entgegen, die genossenschaftliche Großproduktion neben dem staatlichen sozialistischen Sektor in der Landwirtschaft schließlich gänzlich durchzusetzen.[10] Weitere Mitglieder des Politbüros sekundierten, indem sie die ökonomische Ineffizienz vieler LPG nicht auf das Konzept der Kollektivwirtschaft, sondern ausschließlich auf mangelnde organisatorische Fähigkeiten und politische Fehler einzelner Führungskräfte oder Übertreibungen zurückführten. Damit griffen sie auf eine allgemeine Form der Krisenbewältigung im Staatssozialismus zurück. Anstatt politische Fehler zu benennen, wurden Probleme personalisiert, auf ‚Überspitzungen‘ reduziert, als ‚sektiererische‘ Abweichungen denunziert und damit eskamotiert.
Anfang Februar 1957 nahm die ZPKK ihre Ermittlungen gegen Vieweg auf, die am 26. März in den Beschluss des Politbüros mündeten, ihn aus der SED auszuschließen. Schon am 10. März hatte Vieweg den Präsidenten der DDR, Wilhelm Pieck, auf Druck der SED-Führung gebeten, ihn von seinen Ämtern in der DAL zu entbinden und seinem Rücktritt als Ordentliches Mitglied dieser renommierten Institution zuzustimmen. Stubbe befürwortete aber fünf Tage später lediglich die Entlassung Viewegs als Sekretär der Sektion Agrarökonomik und die Beurlaubung als Direktor, während er Ordentliches Mitglied der DAL bleiben sollte.[11]
Nachdem ihn ein dänischer Journalist vor einem bevorstehenden Prozess gegen ihn gewarnt hatte, floh Vieweg Ende März 1957 schließlich mit seiner Assistentin in die Bundesrepublik, wo ihn der SPD-Politiker Herbert Wehner bei sich aufnahm. Unklar bleibt, warum Vieweg im Oktober 1957 in die DDR zurückkehrte. Dort verurteilte ihn das Oberste Gericht zwei Jahre später wegen ‚Staatsverrats‘ zu zwölf Jahren Zuchthaus. 1964 begnadigt und aus dem Zuchthaus Bautzen II entlassen, arbeitete Vieweg ab 1965 am Nordischen Institut der Universität Greifswald. Hier fertigte er auch Gutachten für die Hauptverwaltung Aufklärung des MfS an. Er starb am 2. Dezember 1976 in Greifswald. Am 27. Dezember 1990 rehabilitierte ihn das Landgericht Berlin posthum.[12]
Quelle und Überlieferung
Die Rede Walter Ulbrichts ist in zwei Fassungen überliefert, die hier beide veröffentlicht werden, da sie sich trotz einiger identischer Abschnitte voneinander unterscheiden. Einerseits liegt eine Mitschrift vor, die in der Stiftung Archiv der Parteien und Massenorganisationen im Bundesarchiv (SAPMO-BArch) in Berlin vorliegt.[13] In diesem Text bettet Ulbricht Viewegs Forderungen in den breiteten Kontext der Entstalinisierung nach dem XX. Parteitag der KPdSU ein. Hier wird zu Beginn der Journalist und Philosoph Wolfgang Harich verurteilt, der in der ‚Plattform für den besonderen deutschen Weg zum Sozialismus‘ parteiinterne Reformen verlangt hatte, aber am 29. November 1956 verhaftet worden war, nachdem er auch das Ostbüro der SPD und den westdeutschen Verleger Rudolf Augstein über den Inhalt der Schrift informiert hatte. Harichs Forderung nach einer Unabhängigkeit der osteuropäischen ‚Volksdemokratien‘ und der Republiken der Sowjetunion wies Ulbricht scharf zurück. Auch verweist er in dieser Mitschrift explizit auf den Aufstand in Ungarn, der ab 23. Oktober 1956 dort die kommunistische Diktatur erschüttert hatte, aber bis zum 4. November von sowjetischen Truppen niedergeschlagen worden war. Zudem fällt auf, dass Vieweg in der Mitschrift nicht namentlich, sondern lediglich als Leiter des Instituts für Agrarökonomik erwähnt wird. Demgegenüber werden die konterrevolutionären Ereignisse in Ungarn (und Polen) in dem Stenogramm, das Ulbricht in sein 1961 veröffentlichtes Buch aufnahm, nur knapp erwähnt. Dieses Dokument, das kürzer und inhaltlich enger als die im SAPMO-BArch archivierte Mitschrift ist, konzentriert sich stärker auf das Agrarprogramm Viewegs, der auch genannt wird.
Zu den Gründen für die Unterschiede zwischen den beiden Überlieferungen liegen keine Belege vor. Offenbar bemühte sich Ulbricht nach der Verurteilung Viewegs aber, die Kritik an seiner Diktatur – besonders an der allenfalls halbherzigen Abwendung vom Stalinismus – zu personalisieren und Unabhängigkeitsbestrebungen herunterzuspielen. Darauf deuten auch seine Hinweise auf eine mangelnde Bereitschaft einiger SED-‚Genossen‘ hin, sich für den ‚Aufbau des Sozialismus‘ einzusetzen. Die strukturellen Mängel des staatssozialistischen Regimes in der DDR – einschließlich der Planwirtschaft – werden aber in beiden überlieferten Dokumenten gleichermaßen verdeckt. Die UdSSR erwähnt Ulbricht in der Fassung, die er in seinem Buch publizierte, nicht mehr, vermutlich um Konflikte mit der östlichen Vormacht und besonders Chruschtschow zu vermeiden.
[1] Arnd Bauerkämper, Ländliche Gesellschaft in der kommunistischen Diktatur. Zwangsmodernisierung und Tradition in Brandenburg 1945?1963 (Zeithistorische Studien 21), Köln 2002, S. 71–166.
[2] Jens Schöne, Jenseits der Städte. Der Volksauftand vom Juni 1953 in der DDR, Erfurt 2023, bes. S. 13, 17f., 22; Arnd Bauerkämper, Keine Ruhe auf dem Lande. Formen abweichenden Verhaltens in dörflich-agrarischen Milieus im Sommer 1953, in: Roger Engelmann/Ilko-Sascha Kowalczuk (Hrsg.), Volkserhebung gegen den SED-Staat. Eine Bestandsaufnahme zum 17. Juni 1953, Göttingen 2005, S. 263–297.
[3] Biografischer Überblick in: Andreas Herbst/Winfried Ranke/Jürgen Winkler, So funktionierte die DDR, Bd. 3: Lexikon der Funktionäre, Hamburg 1994, S. 353.
[4] Zit. nach: Kurt Vieweg, Untersuchungen zur Methodik der planmäßigen Standortverteilung der Landwirtschaftlichen Produktion in der Deutschen Demokratischen Republik und Vorschläge für eine neue Form und Praxis der Agrarplanung, unveröff. Diss. Landwirtschaftlich-gärtnerische Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin 1955, S. 41, Bundesarchiv Berlin [im Folgenden: BA], DK-107, A 420/557. Kritik an Viewegs Personalauswahl überliefert in: Stiftung Archiv der Parteien und Massenorganisationen im Bundesarchiv Berlin [im Folgenden: SAPMO-BA], DY 30/IV 2/7/561, Bl. 5–11.
[5] Umfassende Darstellung in: Michael F. Scholz, Bauernopfer der deutschen Frage. Der Kommunist Kurt Vieweg im Dschungel der Geheimdienste, Berlin 1997, S. 24–185.
[6] Erstmals wurde die Ausarbeitung veröffentlicht von Michael F. Scholz, Kurt Viewegs alternative Agrarpolitik 1956, in: Beiträge zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung 36 (1994), S. 78?87. Hier wurde jedoch ein Abschnitt ausgelassen. Vollständige Fassung in: Siegfried Kuntsche, Die Akademie der Landwirtschaftswissenschaften 1951?1999, 2. Halbbd., Leipzig 2017, S. 424–431.
[7] SAPMO-BA, DY 30/IV 2/7/561, Bl. 25, 37, 58?62, 365–370.
[8] Ebd., Bl. 24?27, 34, 35?37, 46?56; Scholz, Bauernopfer [wie Anm. 5], S. 189f., 192–195.
[9] Zit. nach: Karl Schirdewan, Aufstand gegen Ulbricht. Im Kampf um politische Kurskorrektur, gegen stalinistische, dogmatische Politik, Berlin 1994, S. 207f.
[10] SAPMO-BA, DY 30/IV 2/7/561, Bl. 119; Scholz, Bauernopfer [wie Anm. 5], S. 197f.
[11] Kuntsche, Die Akademie [wie Anm. 6], S. 434f.
[12] Scholz, Bauernopfer [wie Anm. 5], S. 200–213.
[13] Für die Recherche danke ich Jannes Bergmann B.A. (Historische Kommission zu Berlin).
Abbildung




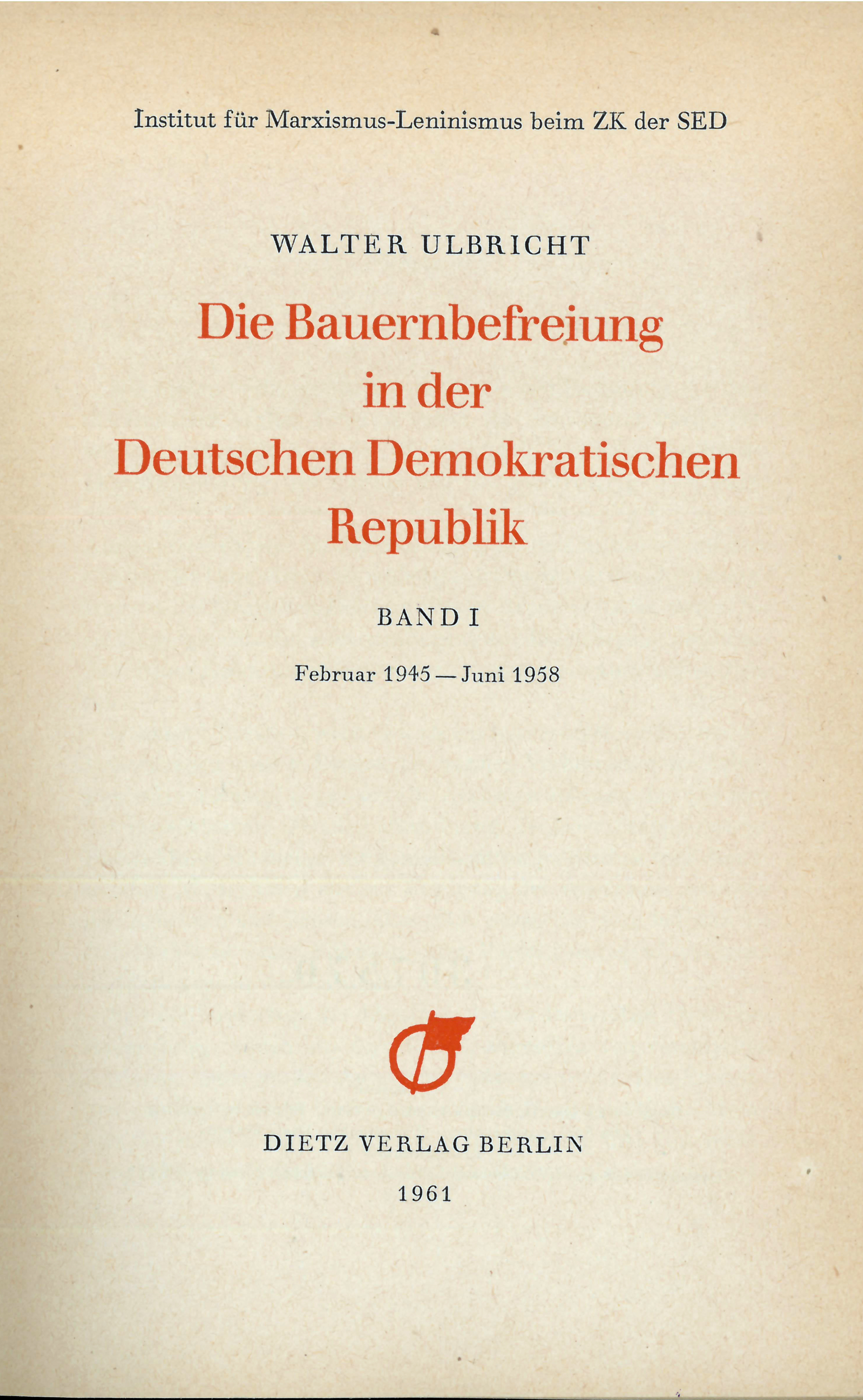
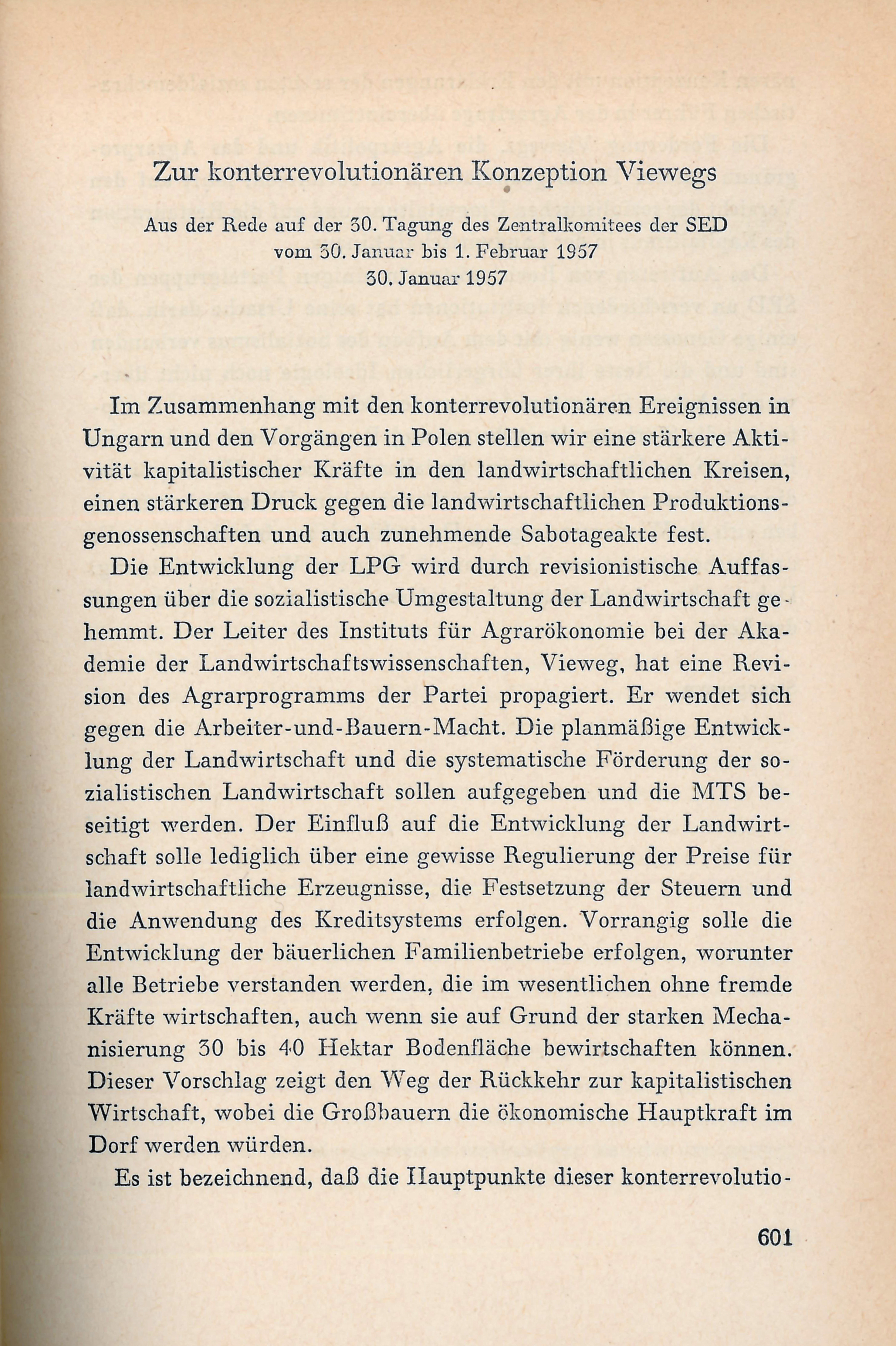
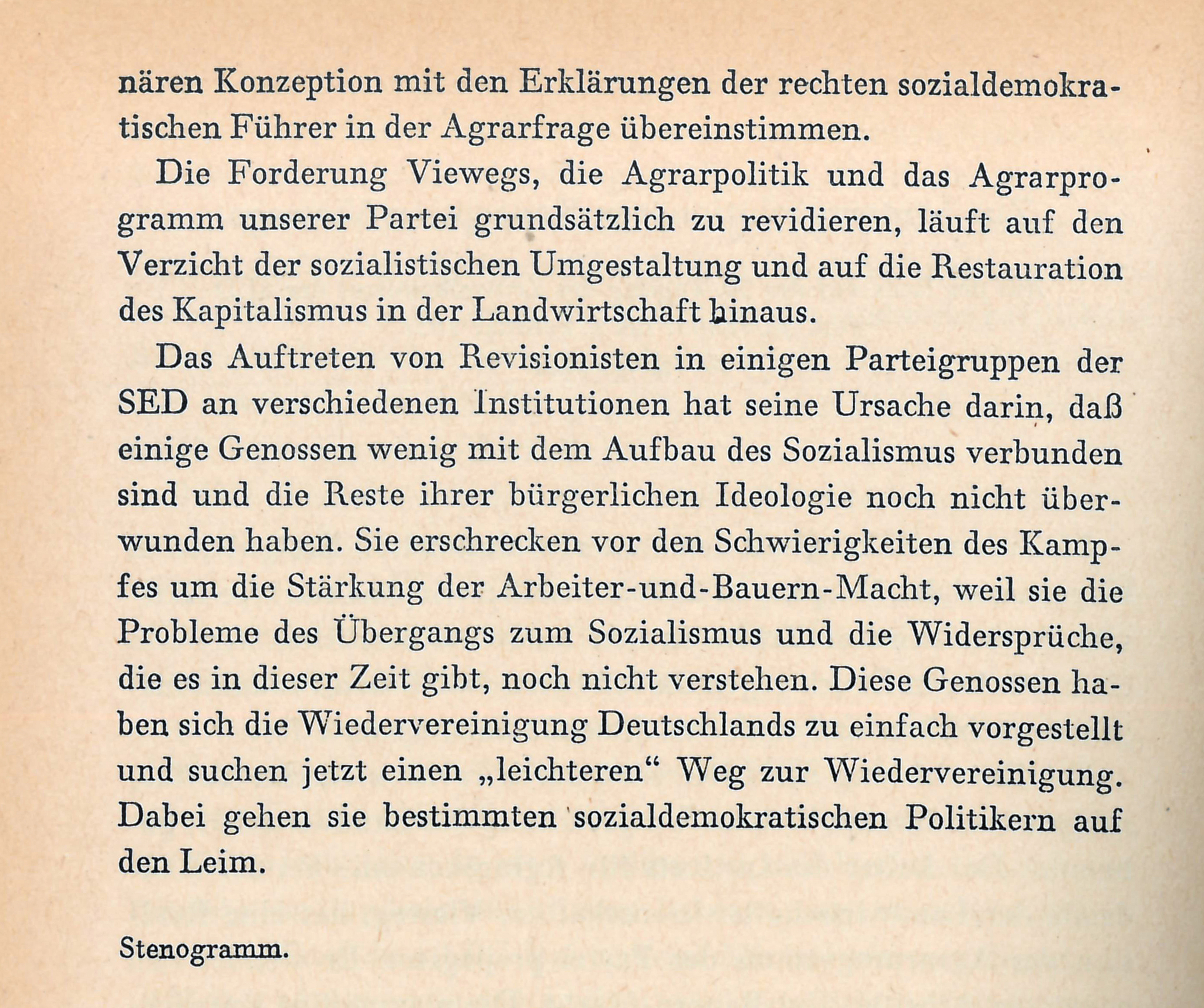
Edition
Die Edition der veränderten Fassung der Rede (abgedruckt in: Walter Ulbricht, Die Bauernbefreiung in der Deutschen Demokratischen Republik, Bd. 1, Berlin 1961, S. 601f.) von Siegfried Kuntsche, Die Akademie der Landwirtschaftswissenschaften 1951–1999, 2. Halbbd., Leipzig 2017, S. 432f. finden Sie hier.
PDF Dokument
Download
Quellen & Literatur
Literatur
Arnd Bauerkämper, Ländliche Gesellschaft in der kommunistischen Diktatur. Zwangsmodernisierung und Tradition in Brandenburg 1945–1963 (Zeithistorische Studien, Bd. 21), Köln 2002.
Michael F. Scholz, Bauernopfer der deutschen Frage. Der Kommunist Kurt Vieweg im Dschungel der Geheimdienste, Berlin 1997.
Empfohlene Zitierweise
Arnd Bauerkämper, Das SED-Regime in Ost-Berlin unter Druck, in: 100 Schlüsselquellen zur Geschichte von Berlin, Brandenburg und Preußen, URL: www.hiko-berlin.de/das-sed-regime-in-ost-berlin-unter-druck [abgerufen am: TT. Monat JJJJ]. Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Textes die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.




