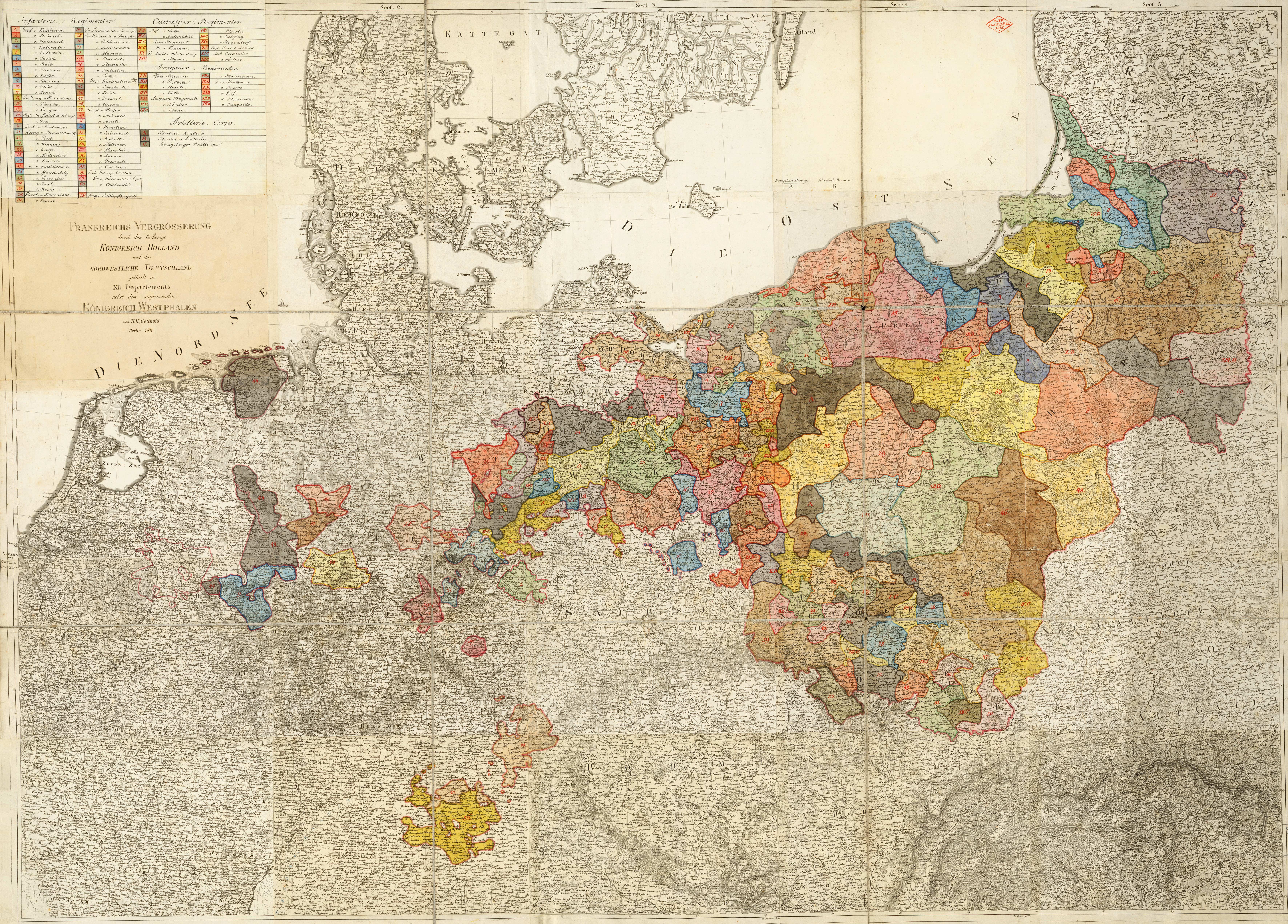Die Preußischen Armeekantone
Zusammenfassung
Die Karte markiert eine Wende in der Entwicklung des spezifisch preußischen Militär-Ersatzwesens. Sie spiegelt das sogenannte ›Kantonsystem‹ wider, das Preußen im 18. Jahrhundert ein hohes militärisches Abschreckungspotential (eine ›formidable Armee‹) sicherte, ohne dass die Produktivkräfte des Landes dadurch nachhaltig in Mitleidenschaft gezogen wurden, sondern guter Haushalt (eine ›solide Menage‹) herrschte.
Kontextualisierung
›Solide Menage‹ und ›formidable Armee‹
Determinanten des preußischen Kantonsystems im 18.Jahrhundert
Jürgen Kloosterhuis
Die Karte markiert eine Wende in der Entwicklung des preußischen Militärwesens und seiner Rekrutierungsmethoden vom 18. zum 19. Jahrhundert. Sie entstand zu einer Zeit, als nach der Niederlage von Jena und Auerstedt 1806 im Zuge der preußischen Reformen die Einführung einer ›Allgemeinen Wehrpflicht‹ für die männliche Bevölkerung nach französischem Vorbild als notwendig erkannt und vorbereitet wurde, sodass sie 1813 in Kraft treten konnte. Vordergründig lief die so wirkungsreiche Maßnahme zunächst auf die Aufhebung aller Dienstbefreiungssachverhalte hinaus, die das Militärersatzgeschäft in Preußen bis dahin zugelassen hatte. Dieses sogenannte ›Kantonsystem‹ war von zwei Faktoren charakterisiert worden: die feste Zuweisung von Verwaltungsbezirken als Aushebungsrayons für die einzelnen Infanterie-, Kavallerie- und (später auch) Artillerie-Regimenter (genau diesen Sachverhalt spiegelte die Kartenkolorierung nach dem preußischen Territorial-Bestand um 1800) und die gleichzeitige Begrenzung der militärischen Aushebungspotentiale im Interesse der vor allem nach 1763 vorrangigen zivilen Wirtschaftsinteressen. So konnte Preußen über ein hohes militärisches Abschreckungspotential (eine ›formidable Armee‹) verfügen, ohne dass die Produktivkräfte des Landes dadurch nachhaltig in Mitleidenschaft gezogen wurden, sondern guter Haushalt (eine ›solide Menage‹) herrschte.
Das Kantonsystem, das nach einer längeren, etwa 1713/18 einsetzenden Entwicklungsphase 1733 in den Kernprovinzen zwischen Elbe und Pregel bzw. 1735 auch zwischen Rhein und Weser festgeschrieben wurde, lief also gerade nicht auf eine allgemeine Wehrpflicht hinaus. Es regelte lediglich die feste Zuweisung von ›Feuerstellen‹ als ländlicher wie städtischer Betriebsgröße zur Nachwuchs-Enrollierung für die Armee, wobei ein Regiment 5.000 bis 6.000 Feuerstellen (in den Kernprovinzen) oder 7.000 bis 8.000 Feuerstellen (an der Peripherie) bekam. Die Enrollierung des männlichen Militärnachwuchses erfolgte bei der Konfirmation, das heißt mit 16 Jahren. Die tatsächliche Indienstnahme besiegelte eine Vereidigung gegebenenfalls bei der jährlichen Kantonrevision. Seitdem musste der dienstpflichtige Mann damit rechnen, mit circa 20 Jahren tatsächlich ins Regiment beziehungsweise bei einer bestimmten Kompanie einrangiert zu werden – wenn er eine Körpergröße von mindestens fünf Fuß drei Zoll (1,65 Meter) oder jedenfalls sechs Zoll (1,73 Meter) aufwies. Maß er gar zwölf Zoll (1,88 Meter), konnte er womöglich zur Potsdamer Garde abkommandiert werden. So oder so erwartete ihn ein zunächst lebenslang definierter Dienst, der tatsächlich nach zwei Jahren Rekruten-Ausbildung mit einer eingeschränkten Beurlaubung wechselte, die jährlich nur zwei Monate Exerzierzeit im April/Mai unterbrachen, also in der Zeit zwischen Aussaat und erster Ernte. Bei ausreichender Ersatzlage konnte der Soldat gegebenenfalls auf seine ständige Beurlaubung hoffen, nach circa 20 Dienstjahren auf seine Verabschiedung. Von vorneherein ›exemt‹, also befreit von der Dienstpflicht, waren alle Burschen unter fünf Fuß drei Zoll (von denen man im Kriegsfall allenfalls eine bestimmte Anzahl als Fuhrknechte einzog), die Söhne von Adel und Offizieren, die Söhne von Bürgern mit Vermögen über 10.000 Talern, mit Haus und Hof angesessene (Land-)›Wirte‹, sowie deren ›einzelne‹ Söhne (wenn die Väter keine weiteren männlichen Nachkommen hatten), Kaufleute, Fabrikanten und Manufakturarbeiter, übrigens auch Theologiestudenten. Alle Nichtkantonisten galten als ›Ausländer‹, vor allem die Soldatensöhne, die man ›skisierte Ausländer‹ nannte und als dem Regiment ohnehin ›obligat‹ einstufte. Zweifellos waren die ländlichen und städtischen Unterschichten am stärksten vom Kantonzwang betroffen, für die er zunächst ›nur‹ auf eine zusätzliche Dienstlast hinauslief, die jene Bedingungen störte, die zum Betrieb beziehungsweise Ausbau der eigenen Wirtschaft nötig waren. Andererseits wurde er durch das Regelwerk des Militärsystems zu einem ›gemessenen‹ Dienst, der zu kalkulieren und damit leistbar war.
Neben dem militärdienstpflichtigen Kantonisten kannte die preußischen Armee noch ein weiteres Strukturelement: den angeworbenen Söldner aus dem ›Ausland‹, worunter das Militär freilich alles begriff, was nicht im eigenen Kanton zu Hause war. Beispielsweise bei dem in Berlin stationierten Infanterieregiment Nr. 13 hieß das zwischen 1746 und 1756, dass die Truppe damals zu etwa 51 Prozent aus eingeborenen Preußen bestand, von denen 36 Prozent Kantonisten und 15 Prozent ›skisierte Ausländer‹ waren, das heißt Soldatensöhne, Männer aus Berlin und Potsdam und vor allem aus Schlesien. Ihnen standen 49 Prozent tatsächliche Ausländer gegenüber, von denen 37,5 Prozent aus Reichsterritorien und 11,5 Prozent aus dem europäischen Raum kamen.
Warum erschien seit Friedrich Wilhelm I. die Körpergröße als primäres Kriterium, das über die Militärdienst-Tauglichkeit eines Mannes entschied? Das resultierte aus der taktischen Voraussetzung des Rekrutierungsprozesses, die bei ›den Preußen‹ – und in ihrer unerbittlich durchgehaltenen Konsequenz im 18. Jahrhundert nur bei diesen – auf die einfache Erkenntnis hinauslief, dass große Männer lange Armspannweiten haben, mit der sie wiederum langläufige Vorderladergewehre besonders effizient in schnellerer Feuerfolge und auf größere Distanz als die ›Konkurrenz‹ bedienen konnten. In diesem waffentechnischen Plus lag lange Zeit das Erfolgs-Geheimnis der ›langen Kerls‹ – und die Quintessenz des preußischen Kantonsystems, in dem zum Zeitpunkt seiner Einführung in den 1730er Jahren
o eben nicht, wie andernorts, die gesellschaftlichen Randgruppen militärdienstpflichtig, sondern die großgewachsenen Männer rekrutiert wurden, und dieses Aushebungskriterium mit dem Exemtionskriterium der wirtschaftlichen Unentbehrlichkeit so gut wie möglich harmonisiert wurde; in dem
o eine staatlich geregelte, aber nicht mehr ständisch-zivil, sondern militärisch durchgeführte, doch allmählich mehr und mehr wiederum von staatlichen Zivilbehörden kontrollierte Aushebung auf der Basis der Enrollierung als vermögensunabhängiger Erfassung der Nicht-Exemten stattfand; und in dem
o die Militär- (Hand-) Dienstleistung faktisch bemessen und an den Arbeitsrhythmus vornehmlich der agrarischen Wirtschaftsbetriebe flexibel angepasst war, wobei es keine Rolle spielte, ob diese guts- oder grundherrschaftlich strukturiert waren.
Vor Einrichtung der Kantone waren die Jahre zwischen 1713 und 1733 in ganz Preußen von einer vom König politisch gewollten Heeresverstärkung geprägt gewesen, die sich im Lande in ebenso rücksichtslosen wie gewaltsamen Rekrutierungsaktionen bei der Menschenjagd auf ›lange Kerls‹ böse bemerkbar gemacht hatte. Im Westen führte dies 1720 in der südwestfälischen Grafschaft Mark zu einem regelrechten Aufstand der Bevölkerung, der nicht zuletzt von den Ortsgeistlichen unterstützt wurde, doch ebenso roh gingen zur selben Zeit am anderen Ende der Monarchie militärische Kommandos beispielsweise bei der Aushebung in Ostpreußen vor, was die Bauern auch dort mit Landflucht quittierten. Sollte die ›solide Menage‹ nicht zum Teufel gehen, musste die Inlands-Werbung sinnvoll geregelt werden – und so wurde das Kantonsystem gleichsam aus wirtschaftlichen Zwängen geboren und in der Folge in einem langen Verhandlungsprozess zwischen zivilen und militärischen Instanzen den ökonomisch-sozialen Bedingungen der Landesteile so genau eingepasst, dass dieser Prozess als Sozialisierung des gesamten Militärsystems beschrieben werden kann, in Mark, Minden und Ravensberg wie in Ostpreußen, in Magdeburg-Halberstadt wie in Pommern oder Brandenburg. Auf lange Sicht dürfte die Dienstpflicht bei den Männern sogar mentalitätsverändernd im emanzipatorischen Sinn gewirkt haben. Die militärische Disziplin verkrustete das Sozialverhalten eben nicht zur blinden Subordination, sondern konnte Selbstbewusstsein in unteren Bevölkerungsschichten generieren.
Die schlesische Kantoneinteilung gab ab 1743 die Probe auf dieses Exempel, da hier von vornherein die Hauptstadt Breslau (Wroc?aw) samt Vorstädten, sowie die Leineweberei- und Garnspinnereiregionen in den sogenannten ›Gebirgskreisen‹, und später auch bestimmte Bergbaustädte kantonfrei blieben. Natürlich wurde die neue Militärpflicht auch von den schlesischen Bauern und Handwerkern zunächst als gewöhnungsbedürftige Dienstlast kritisch betrachtet, doch war sie zumindest im Frieden erträglich austariert, wenn von den tauglichen Kantonisten im neu erworbenen Landesteil jährlich zunächst nur zwischen 0,9 und 1,2 Prozent der männlichen (Land-)Bevölkerung bzw. nach dem Siebenjährigen Krieg die auch andernorts üblichen 5 bis 6 Prozent Rekruten eingezogen wurden.
In der weiteren Diskussion um die Fortentwicklung des Heeresersatzgeschäftes in Preußen erhob das Militär schon sehr früh die Forderung nach einer Ablösung des Kantonsystems durch eine ›Allgemeine Wehrpflicht‹. Weitaus konservativer plädierten dagegen die verschiedenen Landstände um 1790 für die Beibehaltung des Systems, unter Rückgriff auf das Prinzip der selektiven Aushebung nach ›Entbehrlichkeit‹, vereint mit einer Dienstzeitbefristung auf 15 bis 20 Jahre. Solche natürlich die expandierenden Wirtschaftsinteressen bedienenden Auffassungen von Exemtionsausdehnung und Dienstzeitbefristung, die von den zivilen Verwaltungsbehörden und vor allem von der 1788 eingesetzten Kantonreformkommission geteilt wurden, flossen in das neue Kantonreglement von 1792 ein. Diese in allen preußischen Landesteilen zu beobachtende rückläufige Dynamik in der Entwicklung des Kantonsystems und seine ambivalente Akzeptanz bilden einen Maßstab für die Frage nach der Militarisierung Preußens im Ancien Régime. Im Rahmen dieses Systems, mit Blick auf seine besonders seit 1763 einsetzenden Veränderungen und aufgrund der Quantität der von ihm tatsächlich zum Militärdienst herangezogenen Personengruppe bestand im Ancien Régime ›zwischen Königsberg und Kleve‹ kein großer Spielraum für eine nachhaltige Durchdringung der Gesamt-Gesellschaft mit militärischen Verhaltensformen oder Wertvorstellungen. Allerdings gaben das Kantonsystem den Rahmen und die (hier nicht näher vorzustellende) Regimentskultur die Basis einer spezifisch preußischen Militärsozialisation im 18. Jahrhundert. Als Merkmale dieses von 1713 bis 1806 keineswegs statuarischen Zustands, sondern dynamisch verlaufenden Prozesses können abschließend zusammengefasst werden:
1. Die dialektische Interaktion zwischen staatlichen und gegen Ende des 18. Jahrhunderts wieder progressiv beteiligten ständischen Verwaltungsinstanzen bei der Festlegung von bestimmten Militärdienstpflichten, der im militärischen wie zivilen Bereich zum immer stärkeren Zugriff des Staates auf ›seine‹ Untertanen führte,
2. die vorrangige Anpassung der militärischen Aushebung an die regionalen Wirtschaftsinteressen,
3. die gleichzeitige konsequente Ausrichtung des Militärersatzgeschäftes an taktische Anforderungen, und die
4. sicher nicht geplante, aber eigendynamisch angestoßene Initiierung von Mentalitätsveränderungen der einerseits im Militärdienst verstärkt (sozial-)disziplinierten und andererseits durch eben diesen aus alten ständisch definierten Abhängigkeiten allmählich emanzipierten ›Untertanen in Uniform‹.
In diesem Rahmen gab der ›bunte Rock‹ den preußischen Soldaten im 18. Jahrhundert natürlich noch keine Garantie auf bäuerliche Befreiung oder bürgerliche Selbstständigkeit. Er bot ihnen jedoch die Chance, sich aus unverschuldeten Abhängigkeiten allmählich mental abzulösen und so zu einem gesellschaftlichen Strukturwandel beizutragen, der unter dem Eindruck neuer politisch-sozialer Entwicklungen auf das Staatsbürgertum des 19. Jahrhunderts hinauslief.
PDF Dokument
Download
Quellen & Literatur
Editionen
Jürgen Kloosterhuis (Bearb.), Bauern, Bürger und Soldaten. Quellen zur Sozialisation des Militärs im preußischen Westfalen, 1713–1803, 2 Bde., Münster 1992.
Jürgen Kloosterhuis (Bearb.), Legendäre ›lange Kerls‹. Quellen zur Regimentskultur der Königsgrenadiere Friedrich Wilhelms I., 1713–1740, Berlin 2003.
Inventare
Jürgen Kloosterhuis u. a. (Hrsg.)/Peter Bahl/Claudia Nowak/Ralf Pröve (Bearb.), Militär und Gesellschaft in Preußen – Quellen zur Militärsozialisation 1713–1806
[A] Archivalien in Berlin, Dessau und Leipzig, Teil 1, Bd. 1 und 2: Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz; Teil 2: Weitere Archive, Bibliotheken und Museen in Berlin, Dessau und Leipzig; Teil 4: Indices und Systematiken (Veröffentlichungen aus den Archiven Preußischer Kulturbesitz, Arbeitsberichte, Nr. 15, 1–4), Berlin 2015.
[B] Archivalien im Land Brandenburg, Teil 1–2: Brandenburgisches Landeshauptarchiv; Teil 3: Kirchliche, kommunale und sonstige Archive, Sachsystematik und Indices (Quellen, Findbücher und Inventare des Brandenburgischen Landeshauptarchivs, Bde. 26–28), Frankfurt a. M. 2014.
Literatur
Jürgen Kloosterhuis, Kantonsystem und Regimentskultur. Katalysatoren des preußischen Militärsozialisationsprozesses im 18. Jahrhundert, in: Wolfgang Neugebauer (Hrsg.), Oppenheim-Vorlesungen zur Geschichte Preußens an der Humboldt-Universität zu Berlin und der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, Berlin 2014, S. 77–139.
Bernhard R. Kroener, Der historische Ort des Militärs in der Gesellschaft Brandenburg-Preußens – kein Sonderweg der europäischen Geschichte, in: ebd., S. 141–162.
Empfohlene Zitierweise
Jürgen Kloosterhuis, Die Preußischen Armeekantone, in: 100 Schlüsselquellen zur Geschichte von Berlin, Brandenburg und Preußen, URL: www.hiko-berlin.de/Armeekantone (zuletzt abgerufen TT.MM.JJJJ). Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Textes die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.